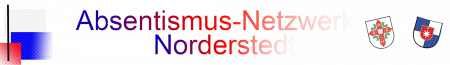maßnahmen bei schulphobie
- Erkennen
Eine Schulphobie zu erkennen ist der erste Schritt. In den meisten Fällen werden die Fehlzeiten über lange Zeit von den Eltern entschuldigt, da das Kind in der Regel noch im Grundschulalter ist und das Vorliegen somatischer Beschwerden über lange Zeit auf eine körperliche Symptomatik hindeutet.
Die typischen Kennzeichen einer Schulphobie sind Folgende:
– die somatischen Beschwerden treten im Zusammenhang mit dem Schulbesuch auf und sind an den Wochenenden oder in den Ferien nicht präsent.
– Die Angst vor der Trennung von den primären Bezugspersonen tritt in der Regel auch in anderen Situationen auf, z.B. Übernachtungen bei Freunden
– Sobald die Trennungssituation in der Schule überwunden ist, macht das Kind in der Regel einen stabilen und zufriedenen Eindruck.
– Die Kinder sind in der Regel leistungsstark und sozial ganz gut eingebunden, außer bei langen Fehlzeiten.
- Verstehen
Die Hintergründe von Schulphobie zu verstehen ist die Grundlage, um sinnvolle zu handeln.
Die Schulphobie ist im eigentlichen Sinne eine Trennungsangst, das betroffene Kind fürchtet die Trennung von den engen Bezugspersonen. Diese Ängste des Kindes befinden sich oft in einer Wechselwirkung mit den Ängsten der Eltern, diese sind oft ambivalent und wünschen sich zum einen, dass das Kind selbständiger wird, zum Anderen haben sie oft Sorgen, dass das Kind den Herausforderungen nicht gewachsen ist.
Die Eltern wünschen sich oft, das Kind möge die Angst besiegen, aber auf eine Art, die schmerzlos ist. Ein grundlegendes Verständnis von Angst zu bekommen und wahrzunehmen, dass es keinen Umgang mit der Angst ibt (im Sinne von die Angst umgehen), sondern der Weg immer durch die Angst hindurch führt, ist wesentlich für die Bereitschaft der Eltern zur Mitarbeit. Das ist das Ziel von Psychoedukation (siehe „Überblick bekommen“)
- Handeln
Im Falle einer Schulphobie ist zügiges Handeln der Erwachsenen ausschlaggebend für den Erfolg einer Wiedereingliederung. Das liegt zum einen am Alter der Kinder (in der Regel Grundschüler) und zum anderen an der komplexen Dynamik des Phänomens, in die in der Regel die gesamte Familie eingebunden ist.
Bei der Interventionsplanung sollten folgende Aspekte bedacht werden:
– Eine enge Kooperation auf der Erwachsenenebene für ein schnelles und koordiniertes Unterbrechen des Absentismus aufbauen
– Fachliche Beratung einbinden (z.B. Schulpsychologie)
– Für ein gemeinsames Verständnis des Absentismus werben, das gelingt gut mit Mitteln der Psychoedukation (siehe „Überblick bekommen), am besten unter Einbindung von Schulpsychologie oder Schulsozialarbeit
– Für die Wiedereingliederung Fachlehrer*innen einbinden
– Kontraindizierte Maßnahmen kennen
- Kooperation und Netzwerk
Bei einer Schulphobie ist das Kind nicht in der Lage, die Verantwortung für den Schulbesuch selbst zu übernehmen.
Das bedeutet für die Eltern und Lehrkräfte, dass diese für eine gewisse Zeit mehr Verantwortung übernehmen müssen, als es normal eigentlich der Fall ist. Es braucht also eine enge Kooperation und gute konkrete Absprachen von Eltern und Lehrkräften, um das Kind wieder an die Schule zu bringen und den Schulbesuch zu verstetigen.
Ein gutes Team zu sein verlangt Eltern udn Lehrkräften viel ab. Der Treibstoff für das Team sind
– Gegenseitige Wertschätzung und Unterstellung, dass man jeweils alles in seinem Rahmen Mögliche tut
– Geduld und Beharrlichkeit, Erwartungsmanagement
– Intensive, positive Kommunikation
- Kolleg*innen und Klasse informieren
Neben dem Kernteam bestehend aus Eltern, Klassenelerkraft und Schulsozialarbeit sielen auch andere Personen in Schule eine wichtige Rolle für den Erfolg einer Wiedereingliederung.
Die Fachlehrer sind wichtig, um das Kind freundlich und unaufgeregt zu empfangen und gerade am Anfang bei der Bewältigung der Angst zu unterstützen. Dabei sollten sie darauf achten, keine ungünstigen Bemerkungen zu machen („Auch mal wieder da“ oder „Du siehst auch nicht gut aus, so blass um die Nase“), nicht direkt am ersten Tag das Kind ohne Melden dranzunehmen oder das Kind bei aufkomenden Schwierigkeiten abholen zu lassen. Deshalb müssen alle Fachlehrer gut über den Wiedereinstieg informiert werden.
Auch die Mitschüler sollten instruiert werden, das Kind in Ruhe ankommen zu lassen und freundlich zu sein.
- Stolpersteine
Bei Schulphobie sollten Sie folgende Stolpersteine besser meiden:
– Zu viel Verständnis und Toleranz bei einer nachsichtigen oder schwankenden Haltung der Eltern.
– Lange Krankschreibungen durch die Eltern ohne hinreichenden Grund akzeptieren.
– Hausunterricht anordnen
– andere unpassende Maßnahmen ergreifen (z.B. Ordnungswidrigkeit anzeigen bei kooperativen Eltern)
– Eltern mit in den Unterricht nehmen
– Das Kind bei Beschwerden nach Hause schicken
– Am Tag der Wiedereingliederung Klassenarbeiten schreiben
– Davon ausgehen, dass das Problem nur von Fachleuten (z.B. Therapeuten) gelöst werden kann